Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierungen der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (»die drei Staaten«)
handelnd auf der Grundlage ihrer langjährigen freundschaftlichen Verbundenheit,
in Würdigung ihres gemeinsamen Eintretens für die Freiheit und Einheit Berlins,
in Anbetracht des Umstands, daß mit Vollendung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit auch die Teilung Berlins endgültig beendet wird,
in Anerkennung der Tatsache, daß mit Abschluß des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland und mit Herstellung der deutschen Einheit die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin ihre Bedeutung verlieren und daß das vereinte Deutschland volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten haben wird,
in der Erwägung, daß es notwendig ist, hierfür in bestimmten Bereichen einschlägige Regelungen zu vereinbaren, welche die deutsche Souveränität in bezug auf Berlin nicht berühren,
im Hinblick auf die zwischen den vier Regierungen geschlossene Vereinbarung über den befristeten Verbleib von Streitkräften der drei Staaten in Berlin
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
(1) Der Ausdruck »alliierte Behörden«, wie er in diesem Übereinkommen verwendet wird, umfaßt
a) den Kontrollrat, die Alliierte Hohe Kommission, die Hohen Kommissare der drei Staaten, die Militärgouverneure der drei Staaten, die Streitkräfte der drei Staaten in Deutschland sowie Organisationen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausgeübt oder – im Fall internationaler Organisationen und andere Staaten vertretender Organisationen (und der Mitglieder solcher Organisationen) – mit deren Ermächtigung gehandelt haben, sowie die Hilfsverbände anderer Staaten, die bei den Streitkräften der drei Staaten gedient haben;
b) die Alliierte Kommandantur Berlin, die Kommandanten des amerikanischen, britischen und französischen Sektors von Berlin sowie Einrichtungen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausgeübt haben.
(2) Der Ausdruck »alliierte Streitkräfte«, wie er in diesem Übereinkommen verwendet wird, umfaßt
a) die in Absatz 1 bezeichneten alliierten Behörden, soweit sie in oder in bezug auf Berlin tätig waren;
b) Angehörige der amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte in Berlin;
c) nicht-deutsche Staatsangehörige, die in militärischer oder ziviler Eigenschaft bei den alliierten Behörden Dienst getan haben;
d) Familienangehörige der unter den Buchstaben b und c aufgeführten Personen und nicht-deutsche Staatsangehörige, die im Dienst dieser Personen standen.
(3) Die amtlichen Texte der in diesem Übereinkommen erwähnten Rechtsvorschriften sind diejenigen Texte, die zur Zeit des Erlasses maßgebend waren.
(4) Soweit in diesem Übereinkommen auf das Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte Bezug genommen wird, ist dies als Bezugnahme auf die Suspendierung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte oder, wenn keine Suspendierung erfolgt, das Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland zu verstehen.
Artikel 2
Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der alliierten Behörden in oder in bezug auf Berlin oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen.
Artikel 3
(1) Deutsche Gerichte und Behörden können im Rahmen der Zuständigkeiten, die sie nach deutschem Recht haben, in allen Verfahren tätig werden, die eine vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin begangene Handlung oder Unterlassung zum Gegenstand haben, soweit in diesem Artikel nicht etwas anderes bestimmt wird.
(2) Eine Zuständigkeit deutscher Gerichte oder Behörden nach Absatz 1 besteht nicht für die folgenden Institutionen und Personen, auch wenn ihre dienstliche Tätigkeit beendet ist, und nicht in den nachstehend genannten Verfahren:
a) die alliierten Behörden;
b) Angehörige der alliierten Streitkräfte in nichtstrafrechtlichen Verfahren, die eine Handlung oder Unterlassung in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zum Gegenstand haben;
c) Angehörige der alliierten Streitkräfte in strafrechtlichen Verfahren, es sei denn, der betreffende Staat stimmt der Einleitung des Verfahrens zu;
d) Richter an den von den alliierten Behörden eingesetzten Gerichten in Berlin und andere Gerichtspersonen, die ihnen bisher in der Freistellung von der deutschen Gerichtsbarkeit gleichgestellt waren, soweit sie in Ausübung ihres Amtes gehandelt haben;
e) Mitglieder der beim Kontrollrat zugelassenen Militärmissionen und Delegationen in Verfahren, die eine Handlung oder Unterlassung in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zum Gegenstand haben;
f) Verfahren, für welche die Genehmigung abgelehnt wurde, die nach Gesetz Nr. 7 der Alliierten Kommandantur Berlin vom 17. März 1950 zur Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit erforderlich war;
g) andere Verfahren, die eine in Ausübung dienstlicher Tätigkeit für die alliierten Streitkräfte begangene Handlung oder Unterlassung zum Gegenstand haben.
(3) Wenn sich in einem Verfahren, auf das Absatz 2 Anwendung findet, die Frage erhebt, ob eine Person in Ausübung ihres Amtes oder ihrer dienstlichen Tätigkeit gehandelt hat, so sind Verfahren nur auf der Grundlage einer Bescheinigung des betreffenden Staates zulässig, daß die fragliche Handlung oder Unterlassung nicht in Ausübung des Amtes oder der dienstlichen Tätigkeit begangen wurde.
(4) Die deutschen Gerichte sind nach Maßgabe des deutschen Rechts für Streitigkeiten zuständig, die sich aus Arbeitsverträgen (einschließlich der damit zusammenhängenden Sozialversicherungsstreitigkeiten) oder Verträgen über Lieferungen und Leistungen ergeben, die vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte geschlossen worden sind. Klagen gegen die Behörden der drei Staaten sind gegen die Bundesrepublik Deutschland zu richten. Klagen dieser Behörden werden von der Bundesrepublik Deutschland erhoben.
Artikel 4
Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten Behörden oder durch eine derselben eingesetzten Gericht oder gerichtlichen Gremium vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie Urteile und Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden behandelt.
Artikel 5
(1) Die Bundesrepublik Deutschland wird keinerlei Ansprüche gegen die drei Staaten oder einen von ihnen oder gegen Institutionen oder Personen, soweit diese im Namen oder im Auftrag der drei Staaten oder eines von ihnen tätig waren, geltend machen wegen Handlungen oder Unterlassungen, welche die drei Staaten oder einer von ihnen oder diese Institutionen oder Personen vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin begangen haben.
(2) Die Bundesrepublik Deutschland erkennt an, daß vorbehaltlich des Artikels 3 die in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche von ihrer Herrschaftsgewalt unterliegenden Personen nicht geltend gemacht werden.
(3) Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die Verantwortlichkeit für die Entscheidung über Entschädigungsansprüche für Besatzungsschäden, die vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin entstanden sind und für die nach den Bestimmungen der Verordnung Nr. 508 der Kommandanten des amerikanischen, britischen und französischen Sektors vom 21. Mai 1951 in ihrer durch spätere Verordnungen und Ausführungsbestimmungen geänderten Fassung Entschädigung zu leisten wäre, und für die Befriedigung dieser Ansprüche, soweit sie nicht bereits geregelt sind. Die Bundesrepublik Deutschland wird bestimmen, welche weiteren der in Absatz 2 genannten und in oder in bezug auf Berlin entstandenen Ansprüche zu befriedigen angemessen ist, und wird die zur Bestimmung und Befriedigung dieser Ansprüche erforderlichen Maßnahmen treffen.
Artikel 6
(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 werden Fragen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die sich aus der Suspendierung oder Beendigung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in Berlin ergeben, im Rahmen der Vereinbarung über den befristeten Verbleib von Streitkräften der drei Staaten in Berlin, einschließlich ihrer Anlagen, behandelt.
(2) Am Ende der in Anlage 2 der genannten Vereinbarung vorgesehenen Abwicklungszeiträume haben die drei Staaten die Gelegenheit, das Vermögen weiterhin zu nutzen, soweit es von ihren diplomatischen und konsularischen Vertretungen benötigt wird, falls angemessene Regelungen (Miete, Tausch oder Kauf) vereinbart werden können.
(3) Im Einklang mit geltenden Verfahren wird bewegliches Vermögen, das nicht mehr für die in der genannten Vereinbarung, einschließlich ihrer Anlagen, bezeichneten Zwecke benötigt wird und das der betreffende Staat nicht kaufen, tauschen oder mieten möchte, an die zuständige deutsche Behörde zurückgegeben.
Artikel 7
(1) Soweit es für den Abschluß von Verfahren, die bei Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte bei dem »Tribunal français de simple police de Berlin« anhängig sind, notwendig ist, übt es seine Gerichtsbarkeit nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften aus. Das »Tribunal français de Berlin« übt seine Gerichtsbarkeit in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des »Tribunal français de simple police de Berlin« aus.
(2) Die in Absatz 1 genannte Gerichtsbarkeit endet im Fall des »Tribunal français de simple police de Berlin« sechs Monate und im Fall des »Tribunal français de Berlin« zehn Monate nach Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte.
(3) Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 4 dieses Übereinkommens finden sinngemäß Anwendung.
Artikel 8
Jede Vertragspartei kann jederzeit um Konsultationen zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens ersuchen. Die Konsultationen beginnen innerhalb von 30 Tagen, nachdem den anderen Vertragsparteien das Ersuchen notifiziert worden ist.
Artikel 9
Jede Vertragspartei kann um eine Überprüfung dieses Übereinkommens ersuchen. Die Gespräche beginnen innerhalb von drei Monaten, nachdem den anderen Vertragsparteien das Ersuchen notifiziert worden ist.
Artikel 10
Ungeachtet des Artikels 11 kommen die Unterzeichnerregierungen überein, dieses Übereinkommen vom Zeitpunkt des Unwirksamwerdens der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig anzuwenden.
Artikel 11
(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt. Diese Regierung teilt den anderen Unterzeichnerregierungen die Hinterlegung jeder Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde mit.
(2) Dieses Übereinkommen tritt am Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(3) Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen deutscher, englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt; diese übermittelt den anderen Unterzeichnerregierungen beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Bonn am 25. September 1990
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Lautenschlager
Für die Regierung der Französischen Republik
Boidevaix
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
Vernon A. Walters
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
Christopher Mallaby
 Auf gar nicht so wenigen Internetseiten wird mittlerweile behauptet, der Einigungsvertrag (genauer: das Gesetz, mit dem Bundestag und Bundesrat der Wiedervereinigung, dem Einigungsvertrag, den damit einhergehenden Grundgesetzänderungen und zahlreichen Übergangs- und Anpassungsregeln zugestimmt haben) sei nichtig.
Auf gar nicht so wenigen Internetseiten wird mittlerweile behauptet, der Einigungsvertrag (genauer: das Gesetz, mit dem Bundestag und Bundesrat der Wiedervereinigung, dem Einigungsvertrag, den damit einhergehenden Grundgesetzänderungen und zahlreichen Übergangs- und Anpassungsregeln zugestimmt haben) sei nichtig.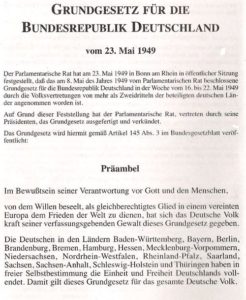 Es ist also keineswegs der gesamte Einigungsvertrag nichtig, sondern nur eine minimale Regelung, nämlich Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 und 5 sowie Absatz 3. Und auch hier betrifft die Ungültigkeit lediglich Abweichungen von den Kündigungsvorschriften des Mutterschutzrechts.
Es ist also keineswegs der gesamte Einigungsvertrag nichtig, sondern nur eine minimale Regelung, nämlich Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 und 5 sowie Absatz 3. Und auch hier betrifft die Ungültigkeit lediglich Abweichungen von den Kündigungsvorschriften des Mutterschutzrechts.