Heute kann man ohne Weiteres die Urteile auch der höchsten Gerichte ohne große Umstände einzusehen – das Internet macht’s möglich und ist auch an der Justiz nicht spurlos vorbeigegangen. Darum möchten wir heute einmal ein echtes BGH-Urteil vorstellen und es erläutern.
Es geht um das Urteil mit dem Aktenzeichen 5 StR 41/14 vom 18. Februar 2014, das als Original-PDF auf den Seiten des BGH abrufbar ist.
BESCHLUSS
Die übliche Einleitungsformel einer Entscheidung. Daran, dass hier „Beschluss“ drübersteht, erkennt man schon, dass es keine mündliche Verhandlung gegeben hat, sondern nach Aktenlage entschieden wurde. Eine richtige Hauptverhandlung findet äußerst selten statt (in ca. 5 % der Fälle), da es ja nur noch um Rechtsfragen geht, die man meistens anhand der Akten entscheiden kann und keine Zeugenvernehmungen o.ä. notwendig sind. Wird nach einer mündlichen Verhandlung entschieden, wird die Entscheidung mit „Urteil“ überschrieben.
5 StR 41/14
vom
18. Februar 2014
Das Aktenzeichen verrät einiges über die Entscheidung:
- StR bedeutet, dass es sich um eine Revision in Strafsachen vor dem Bundesgerichtshof handelt.
- Die vorangestellte 5 sagt aus, dass der fünfte Strafsenat des BGH entschieden hat. Wie alle Gerichte ist auch der BGH in verschiedene „Abteilungen“ gegliedert, es entscheiden also nicht immer die gleichen Richter über alle Fälle. Der fünfte Senat ist bspw. für den Osten Brandenburgs, für Berlin, für den Westen des Saarlands, für Bremen, für Schleswig-Holstein und für den Norden Niedersachsens zuständig.
- Das Verfahren war das 41. des Jahres, in dem der Fall eingereicht wurde, und
- dieses Jahr war 2014.
Die Aktenzeichen dienen also nicht nur der Durchnummerierung der Urteile, sondern erlauben auch gleich eine rechtliche Einordnung. Bei einem Urteil mit „StR“ im Aktenzeichen wird es also in aller Regel nicht um zivilrechtliche Fragen gehen und ein Urteil mit „/21“ am Ende hat schon bald 100 Jahre auf dem Buckel und entspricht möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Stand der Rechtsprechung.
in der Strafsache
gegen
(…)
wegen besonders schweren Raubes u.a.
Das Urteil ist anonymisiert, darum wird der Name des Verurteilten in diesem „Rubrum“ (das „Rotgeschriebene“, weil früher für den Kopf des Urteils tatsächlich rote Farbe verwendet wurde) vollständig ausgeblendet. Im weiteren Text des Urteils werden die Namen meist abgekürzt wiedergegeben, damit man die Akteure auseinanderhalten kann.
1. Auf die Revision des Angeklagten W. wird das Urteil des Landgerichts Zwickau vom 30. Oktober 2013 – auch soweit es die Mitangeklagte B. betrifft – nach § 349 Abs. 4 StPO mit den zugehörigen Feststellungen aufgehoben.
Das Gericht hat nach § 349 Abs. 4 StPO entschieden, also die Revision einstimmig für begründet befunden. Daher wurde das vorherige Urteil des Landgerichts aufgehoben, und zwar „mit den Feststellungen“. Das bedeutet, dass auch die Tatsachenfeststellungen von der Aufhebung betroffen sind und nicht lediglich die rechtlichen Schlussfolgerungen. Blieben die Feststellungen erhalten, müsste nur noch aufgrund dieser Tatsachen eine juristische Wertung erfolgen, also Freispruch oder Verurteilung wegen einer bestimmten Straftat sowie ggf. die Festlegung des Strafmaßes.
Übrigens kommt dieser Erfolg auch der „Mitangeklagten B.“ zugute, obwohl sie selbst gar kein Rechtsmittel eingelegt hat. Dazu aber später mehr.
2. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
Der Bundesgerichtshof hat nur das bisherige Urteil aufgehoben, er entscheidet nicht selbst in der Sache. Das Landgericht muss also nun eine neue Verhandlung durchführen. Gegen dieses Urteil könnte dann übrigens wiederum Revision zum BGH eingelegt werden.
Das Landgericht hat den Angeklagten W. wegen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt; die nichtrevidierende Mitangeklagte B. hat es wegen Raubes in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt und deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt.
Hier wird ganz knapp dargestellt, wie das vorherige Urteil lautete.
Die auf die Sachrüge gestützte Revision des Angeklagten hat Erfolg.
Das Ergebnis des Verfahrens: Die Revision hat Erfolg.
Dabei handelte es sich um die sogenannte „Sachrüge“, mit der eine falsche Anwendung des Strafrechts moniert wird. Konkret soll das Landgericht also Fehler bei der Bestimmung dessen, was ein Raub laut StGB ist und ob sich die Angeklagten dessen schuldig gemacht haben, gemacht haben. Der Gegenbegriff ist die Verfahrensrüge, mit der Fehler bei der Prozessführung geltend gemacht werden. Außerdem gibt es noch die Aufklärungsrüge, die dann greift, wenn das Gericht den Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt hat und es noch Lücken in den Feststellungen gibt.
1. Nach den Feststellungen besuchten am 20. April 2013 der Angeklagte W. und die Angeklagte B. , die von ihrer Tochter und deren Freund, dem gesondert Verfolgten S. begleitet wurde, die geschädigten Eheleute F. in deren Wohnung (…) entwendeten der Angeklagte W. und S. aus der Wohnung der Eheleute F. „ungestört in Ausnutzung der fortwirkenden Gewalt“ Gegenstände im Gesamtwert von ca. 100 €. Die Angeklagte B. machte sich die Wegnahme zu eigen, indem sie half, die entwendeten Sachen in ihre Wohnung zu tragen (Fall II.2 der Urteilsgründe).
Eine Rekapitulation der Tatsachen, die das Ausgangsgericht festgestellt hat. Damit wird praktisch die Grundlage gelegt, auf der die Entscheidung erst getroffen werden kann.
2. Diese Feststellungen tragen die Verurteilung des Angeklagten W. wegen Raubes und besonders schweren Raubes (§ 249 Abs. 1, § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB) nicht.
Welcher Fehler lag vor? Die Feststellung („W hat das gemacht, B hat das gemacht“) sind nicht mit dem Urteil („W und B sind des Raubes schuldig“) vereinbar. Warum das so ist, wird danach näher ausgeführt. Das ist der sogenannte Urteilsstil, weil er von Gerichten angewandt wird: Das Ergebnis wird vorweg gestellt, danach wird es begründet.
Nach ständiger Rechtsprechung muss zwischen der Drohung mit oder dem Einsatz von Gewalt und der Wegnahme beim Raub eine finale Verknüpfung bestehen; Gewalt oder Drohung müssen das Mittel zur Ermöglichung der Wegnahme sein.
Die allgemeine (Teil-) Definition des Raubs.
An einer solchen Verknüpfung fehlt es, wenn eine Nötigungshandlung nicht zum Zwecke der Wegnahme vorgenommen wird, sondern der Täter den Entschluss zur Wegnahme erst nach Abschluss dieser Handlung fasst
Nähere Spezifizierung: Wann sind die Voraussetzungen des Raubs gerade nicht erfüllt?
(vgl. BGH, Urteil vom 22. September 1983 – 4 StR 376/83, BGHSt 32, 88, 92; Urteil vom 20. April 1995 – 4 StR 27/95, BGHSt 41, 123, 124; Urteil vom 16. Januar 2003 – 4 StR 422/02, NStZ 2003, 431, 432; Beschluss vom 24. Februar 2009 – 5 StR 39/09, NStZ 2009, 325; MünchKomm/Sander, StGB, 2. Aufl., § 249 Rn. 31 mwN)
Eine äußerst umfangreiche Übersicht über Gerichtsurteile und juristische Kommentare (hier: der „Münchner Kommentar“, Autor des zitierten Abschnitt ist ein Herr Sander), die die Ansicht zur Raubdefinition stützen. Das „mwN“ bedeutet „mit weiteren Nachweisen“, also stehen im Münchner Kommentar wieder andere Quellen, die man sich auch noch zu Gemüte führen kann.
Hier hatte sich der Angeklagte nach den Feststellungen jeweils erst nach seiner letzten Gewaltanwendung zur Wegnahme entschlossen. Eine Äußerung oder sonstige Handlung des Angeklagten vor der Wegnahme, die eine auch nur konkludente Drohung mit weiterer Gewalt beinhaltete, ist nicht festgestellt.
Übertragung der Rechtslage auf den konkreten Fall. Ein Raub liegt demnach nicht vor.
3. Die Sache bedarf deshalb insgesamt neuer Verhandlung und Entscheidung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Landgericht in neuer Hauptverhandlung Feststellungen zu treffen vermag, die eine Verurteilung wegen Raubdelikten stützen.
Es könnte aber sein, dass bei einer erneuten Prüfung weitere Tatsachen zu Tage gefördert werden, auf die man bisher keinen Wert gelegt hat, weil der Raubvorwurf aus Sicht des Landgerichts bereits bewiesen war. Nun weiß man, die rechtlichen Voraussetzungen eines Raubs doch nicht gegeben sind. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es weitere, bisher unberücksichtigte Fakten gibt, die doch eine Verurteilung wegen Raubes ergeben. Daher können die Täter nicht einfach freigesprochen werden, sondern es muss eine neue Verhandlung stattfinden, die der Sache weiter auf den Grund geht.
Da der aufgezeigte materiellrechtliche Fehler des Urteils die nicht revidierende Mitangeklagte B. in gleicher Weise betrifft, ist die Aufhebung auf sie zu erstrecken, nachdem sie – zum Antrag des Generalbundesanwalts auf Entscheidung nach § 357 StPO über ihren Verteidiger angehört – einer solchen Erstreckung nicht widersprochen hat.
Auch Frau B. wurde angeklagt und vom Landgericht verurteilt. Möglicherweise hat sie aber eine untergeordnete Rolle gespielt oder es gab Gesichtspunkte zu ihren Gunsten. Jedenfalls wurde sie nicht zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt, sondern bekam lediglich 21 Monate auf Bewährung. Wenn sich ein Verurteilter denkt „Damit bin ich ja noch glimpflich davongekommen“ oder er die Kosten eines Revisionsverfahren scheut, dann kann er das Urteil selbstverständlich einfach auf sich beruhen lassen und kein Rechtsmittel einlegen.
Hier war es jedoch so, dass der Mitangeklagte in Revision ging und daraufhin das Urteil aufgehoben wurde. Damit wäre es eigentlich so, dass gegen ihn neu verhandelt werden müsste, während es für die Komplizin beim alten Urteil bleibt. Das würde aber bedeuten, dass ein vom zuständigen Gericht als falsch bezeichnetes Urteil Bestand hätte. Das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien schwer vereinbar, darum wirkt gemäß § 357 StPO eine Revisionsentscheidung grundsätzlich zugunsten aller Angeklagter.
Einen Nachteil kann die Angeklagte B darauf nicht haben, denn das neue Urteil darf nicht schwerer wiegen als das alte (§ 358 Abs. 2 Satz 1 StPO)
Basdorf Sander Schneider Berger Bellay
Und schließlich noch die Unterschriften aller beteiligter Richter. Wichtig ist, dass diese Unterschriften auf dem Originalurteil (das in den Gerichtsakten bleibt) handschriftlich unterzeichnen müssen. Erfolgt das nicht innerhalb der gesetzlichen Frist, ist das Urteil fehlerhaft.
Auf den Ausfertigungen, die den Beteiligten zugeschickt werden, werden die Unterschriften (wie hier) durch die maschinenschriftliche Namenswiedergabe bezeugt. Der Urkundsbeamte prüft also (zumindest theoretisch), ob die Richter unterschrieben haben und setzt deren Namen unter das Urteil. Anschließend stempelt und unterschreibt er selbst zum Beweis der Übereinstimmung mit dem Original.
Dieser Prüfvorgang muss sich aber auch aus der Ausfertigung ergeben. Bereits in den 1920er-Jahren wurde festgestellt, dass eine bloße Wiedergabe mit „gez. Richter“ nicht ausreichend ist, da daraus nicht hervorgeht, dass tatsächlich alle Richter einzeln unterschrieben haben.
Fazit
So ein Urteil ist kein Hexenwerk. Man kann es einigermaßen gut lesen und wenn man gewisse Konventionen kennt, ist auch einigermaßen verständlich, warum ein Urteil genau so formuliert ist und welche Folgen sich daraus ergeben.
 Auf gar nicht so wenigen Internetseiten wird mittlerweile behauptet, der Einigungsvertrag (genauer: das Gesetz, mit dem Bundestag und Bundesrat der Wiedervereinigung, dem Einigungsvertrag, den damit einhergehenden Grundgesetzänderungen und zahlreichen Übergangs- und Anpassungsregeln zugestimmt haben) sei nichtig.
Auf gar nicht so wenigen Internetseiten wird mittlerweile behauptet, der Einigungsvertrag (genauer: das Gesetz, mit dem Bundestag und Bundesrat der Wiedervereinigung, dem Einigungsvertrag, den damit einhergehenden Grundgesetzänderungen und zahlreichen Übergangs- und Anpassungsregeln zugestimmt haben) sei nichtig.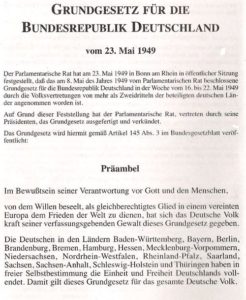 Es ist also keineswegs der gesamte Einigungsvertrag nichtig, sondern nur eine minimale Regelung, nämlich Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 und 5 sowie Absatz 3. Und auch hier betrifft die Ungültigkeit lediglich Abweichungen von den Kündigungsvorschriften des Mutterschutzrechts.
Es ist also keineswegs der gesamte Einigungsvertrag nichtig, sondern nur eine minimale Regelung, nämlich Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 und 5 sowie Absatz 3. Und auch hier betrifft die Ungültigkeit lediglich Abweichungen von den Kündigungsvorschriften des Mutterschutzrechts.