Unter dem staatlichen Integritätsinteresse versteht man das Recht derzeit existenter Staaten, als solche bestehen zu bleiben und die Sezession von Staatsteilen nicht anzuerkennen. Das Integritätsinteresse ist also gewissermaßen der Antagonist des Selbstbestimmungsrechts. Letzteres zu begründen fällt nicht schwer: Es ist gerade ein Ausfluss des Demokratieprinzips, dass sich die Menschen nicht nur die Machthaber in ihrem Staat, sondern auch den Staat an sich auswählen können. Wie begründet man aber nun das Recht eines Staates, so zu bleiben, wie er ist?
Im Völkerrecht kann man das in erster Linie utilitaristisch beantworten: Wenn Staaten miteinander auf internationaler Ebene interagieren, dann gestehen sie sich gerne gegenseitig die Befugnis zu, als Gesamtstaat erhalten zu bleiben. Andernfalls würden sie ihre politischen Partner und auch sich selbst juristisch einengen. Wenn, anders gesagt, die Bundesrepublik ihr Integritätsinteresse gegen die Unabhängigkeit Bayerns ausspielen will, dann ist es für andere Nationen erst einmal pragmatischer, den bewährten Partner Deutschland zu unterstützen als sich auf die bayerische Seite zu schlagen und für die theoretische Chance auf kommende gute Beziehungen die bestehenden zur Bundesrepublik zu riskieren. Und wenn es die Gesamtstaaten sind, die untereinander internationale Politik machen, dann verwundert es nicht, dass diese auch allgemein das Integritätsinteresse gerne in den Kanon des Völkerrechts aufnehmen.
Die KSZE-Schlussakte von Helsinki betont so auch mehrfach die „territoriale Integrität der Staaten“. An anderer Stelle dagegen findet man ein derart klares und umfassendes Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, dass es zunächst wie ein Widerspruch wirkt:
Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker haben alle Völker jederzeit das Recht, in voller Freiheit, wann und wie sie es wünschen, ihren inneren und äußeren politischen Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach eigenen Wünschen zu verfolgen.
Wie es mit internationalen Verträgen so ist, bestehen sie ganz gern aus gut gemeinten Absichtserklärungen ohne größeren Bezug zur Realität. Insofern darf man weder das Selbstbestimmungsrecht noch das Integritätsinteresse unmittelbar für ernst nehmen. Dazu kommt, dass Helsinki 1975 ein Kind des Kalten Kriegs war. Es ging weniger um eine Verfassung des Völkerrechts auf rechtsphilosophischer Ebene als um einen Katalog von Absichtserklärungen zur praktischen Friedenserhaltung. Beide Prinzipien werden durch die Schlußakte auch keineswegs erfunden, sondern waren im Völkerrecht auch vorher schon anerkannt und wurden nur noch einmal bekräftigt und kodifiziert. Sie bekommen insoweit aus der Spannungssituation des Kalten Kriegs heraus eine eigene Bedeutung, indem sich die Staaten gegenseitig, ob verbündet oder feindlich gesinnt, ihr Existenzrecht zuerkennen. Sie beziehen sich also in erster Linie auf die Abwehr einer von außen kommenden Macht; insoweit sind sich Integrität und Selbstbestimmung näher als man dem antithetischen Ansatzpunkt zunächst entnehmen könnte.
Wenn uns die Begriffsgenese in der KSZE-Schlußakte zu einer Synthese von Integrität und Selbstbestimmung im Bezug auf bestehende Staatsgebilde führt, dann löst dies den Konflikt beider Prinzipien im Verhältnis zwischen Glied- und Bundesstaat, wo sich Integrität der oberen und Selbstbestimmung der unteren Ebene entgegenstehen, noch nicht sofort. Spinnt man diese Ideen jedoch weiter, so würde dies bedeuten, dass der Gesamtstaat beides für sich beanspruchen kann, der Teilstaat jedoch weder noch: Er ist nicht selbstbestimmt, weil er sich nicht aus der Föderation und damit auch nicht aus der Mitbestimmung anderer Bundesländer lösen kann; und sein Staatsgebiet besteht zwar als geographische Einheit, hat aber jede Bedeutung verloren. Eine solche Herabstufung und derartige Geringschätzung ist zumindest der deutschen Bundesstaatskonzeption völlig fremd. Aber auch allgemeiner gesprochen vernachlässigt dieses Stufenverhältnis, dass es innerhalb des föderalen Staates aber auch ein inneres „Außen“ gibt: Ein Angriff seitens des Gesamtstaates auf seine Glieder wäre nichts anderes als die angemaßte Fremdbestimmung zwischen verschiedenen Staaten, die das internationale Recht auch schon vor Helsinki ablehnte. Dieses „Außen“ mag freilich eine andere Qualität haben. Aber beide Konstellationen drehen sich um dieselbe Systematik aus Integrität und Selbstbestimmung.
Auch der Teilstaat muss also, wenn man wenigstens seine rudimentäre Staatlichkeit anerkennen will, zumindest die Möglichkeit zur Abwehr von Angriffen des Zentralstaats haben. Dieses „defensive Selbstbestimmungsrecht“ ist wohl auch durchaus anerkannt. Ein aktives, auf Sezession gerichtetes Recht dagegen räumt bspw. der Völkerrechtler Matthias Herdegen einem Teilvolk nur für den Fall einer tiefgreifender Diskriminierung und eines Ausschlusses vom demokratischen Prozeß ein. Wenn also ein Volk einfach nur in der Minderheit ist und von seinen Bundesbrüdern zwar demokratisch, aber dennoch permanent überstimmt wird, hat es kein Recht auf einseitige Loslösung. Und wenn die Föderation auf diese formell korrekte Weise ihre eigenen Befugnisse zu Lasten der Glieder immer weiter ausdehnt, dann könnten sich diese nach Herdegen nicht aus der Umklammerung befreien. Das wirft dann schließlich die Frage auf, wo denn der Unterschied zwischen einer außer- und einer innerföderalen Einmischung liegen soll. Einen solchen könnte man nur annehmen, wenn man – wie oben bereits ausgeführt – die Staatlichkeit des Teilstaats völlig im Gesamtstaat aufgehen lassen würde. Der Teilstaat hätte sich damit enteignet, Selbstbestimmungs- und Integritätsrecht würden dabei zentralisiert, mit der Folge, dass der Angriff eines ausländischen Staates auf ein Teilgebiet nur durch die Föderation abwehrbar wäre, nicht aber durch die Betroffenen selbst. Dem Teilstaat würde nicht einmal Unrecht geschehen, wenn der Gesamtstaat ihn verkaufen oder sonst einem anderen Staat einverleiben würde. Sogar das defensive Selbstbestimmungsrecht bekäme damit einen neuen Adressaten, taugt also nicht einmal als Minimalgarantie. Diese Theorie ist nunmehr wohl ausreichend ad absurdum geführt.
Nicht völlig abwegig ist jedoch die These, dass das Selbstbestimmungs- nur eine Art Notrecht darstellt: Die sezessionswillige Region wurde ja in irgendeiner Form in den umgebenden Staat geführt und hat somit bewußt seine Rechte aufgegeben. Wenn sie das – unveräußerliche – Selbstbestimmungsrecht ausüben will, dann muss sie dafür Schadenersatz leisten. Der Gesamtstaat hat dies hinzunehmen, kann jedoch eine Rechnung dafür ausstellen („dulde und liquidiere“). Diese Ansicht halte ich jedoch nicht (mehr) für richtig. Denn sie setzt, indem sie überhaupt einen Schaden annimmt, ein monetäres und nicht nur, wie im Integritätsinteresse, moralisches Interesse des Gesamtstaates am Erhalt aller seiner Teile voraus. Insoweit ist die Frage nach der Natur dieses Interesses auch jenseits der – zu verneinenden – Frage des Schadensersatzanspruchs relevant.
1. Dieses Interesse kann zum einen ein Planungsinteresse sein. Der Staat braucht ein gewisses Vertrauen auf die Stabilität des derzeit bestehenden Gefüges. Nur so kann er Entscheidungen treffen, die auch morgen noch Bestand haben. Dem muss man entgegenhalten, dass ein Austritt nicht aus dem Nichts heraus und ohne Vorlauf geschieht. Wenn der sezessionswillige Teil eine gewisse Frist einhält, dann kann sich der zurückbleibende Reststaat auf die neue Situation einstellen – so, wie es in der Tagespolitik bei Neuerungen in sozialer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Hinsicht geschieht.
2. Denkbar wäre auch ein Machtinteresse des Staates. Die internationale Position eines Landes ist in hohem Maße von seiner Bedeutung in vielerlei Hinsicht abhängig, die durch jede Verkleinerung Schaden nehmen würde. Dem muss entgegengehalten werden, dass der Ausbau der Machtposition des Gesamtstaates dann gerade durch völlige Ausschaltung jeglicher zwischenstaatlicher Bedeutung der Teilstaaten geschieht. Das Interesse nach überhaupt stattfindender Repräsentation überwiegt wohl sogar den Anspruch auf quantitativen Machterhalt. (Ganz davon abgesehen, dass die Evolution der Staaten momentan eher auf Dezentralisierung, Subsidiarität und Regionalismus dringt und die Zeit der starken Großreiche der Vergangenheit angehört.)
3. Das ökonomische Interesse wäre auf die Nutzung der Ressourcen des Gebietes sowie auf die Steuern der betreffenden Bürger gerichtet. Würde man das bejahen, dann wäre dies wiederum eine völlige Preisgabe jeder Integrität des Teilstaats. Dieser würde in dieser Anschauung zum Objekt der Ausbeutung durch die Zentralregierung – ein Zustand, der möglicherweise sogar das defensive Selbstbestimmungsrecht auslösen würde.
4. Das Argument der Friedenssicherung kann zumindest als durch die Praxis überholt gelten. Das Geschehenlassen der Sezession ist jedenfalls der unblutigere Weg gegenüber dem oft jahrzehntelangen Scharmützel von Aggression und Repression.
5. Möglicherweise kann sich eine – präsumptiv demokratisch – gewählte Staatsmacht auf den Volkswillen stützen. Sie ist aus Wahlen im gesamten Land hervorgegangen und kann damit Geltung auch im gesamten, ungeschmälerten Land beanspruchen. Dies verkennt aber bspw. die Sezession der amerikanischen Südstaaten, die gerade aufgrund eines geographisch höchst gespaltenen Wahlergebnisses ihre Unabhängigkeit erklärten. Zum anderen stellt das Argument die in der Sache weiter entfernte (und häufig genug exterritoriale) Zentralgewalt über die Regionalgewalt. Die Staatsmacht, ob nun eine allgemein akzeptierte Verfassung, eine gewählte Volksvertretung oder eine Regierung, ist zudem nur funktional in ihrem Wirkungsbereich eingesetzt und mit der Frage der Unabhängigkeit nicht weiter befaßt. Wenn nun der regional und sachlich spezifische Wille nach Eigenstaatlichkeit vorhanden ist, wie kann dann eine allgemeinpolitisch begründete und gesamtstaatliche Abstimmung dem vorgehen?
6. Erhaltung des Status quo: Im Recht hat grundsätzlich der bestehende Zustand im Zweifel die Vermutung der Richtigkeit für sich. Wer eine Sache, die sich im Besitz eines anderen befindet, für sich will, braucht einen Anspruch und muss diesen beweisen. So kann man auch begründen, dass ein bestehender Staat keine Rechtfertigung für sich braucht. Jedoch ist dieser Zustand nicht sakrosankt. Mehrheiten ändern sich, Rahmenbedingungen ändern sich und überhaupt ändert sich auch das Verhältnis der Staaten zueinander. Dass ein einmal erfolgter Beitritt, gleich einem unkündbaren Vertrag, für alle Ewigkeit Geltung beanspruchen können soll, würde die Realpolitik ausblenden. Wie könnte sich ein Volk aus Bürgern natürlich begrenzter Lebensdauer oder gar eine Regierung mit gesetzmäßig zeitlich begrenztem Mandat anmaßen, für alle Zeiten eine Entscheidung zu treffen, die alle Nachfolgenden bindet? Welche Vereinbarung Gliedstaat und Bund auch geschlossen haben, sie kann nur innerhalb der Handlungsbefugnis der Beteiligten geschehen sein. Es gibt kein Recht, über seine eigene Wirkungsspanne hinaus Festlegungen zu treffen. Es gibt kein Recht für den so gebildeten, vergänglichen Staat auf ewiges, unverändertes Bestehen; und wenn dem Status quo ein wirksam ausgeübtes Selbstbestimmungsrecht entgegensteht, dann wird er eben reformiert.
Wenn man nach all dem überhaupt ein Integritätsinteresse des Staates annehmen will, dann ist auch dieses nur eine Vermutung, die durch qualifizierte demokratische Willensäußerung (und auf die will ja kaum ein Separatist verzichten) entkräftet werden kann. Das Recht eines Staates, sich mit keiner Änderung abfinden zu müssen, ist jedenfalls nicht beachtlicher als das Recht einer Regierung, wiedergewählt zu werden: Wenn der Volkswille anderes wünscht, dann ist dieser Wille nicht nur sein Himmelreich, sondern rechtlich und demokratiepolitisch maßgeblich.
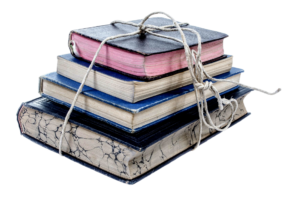 Das Bundesverfassungsgericht hat neuerlich
Das Bundesverfassungsgericht hat neuerlich