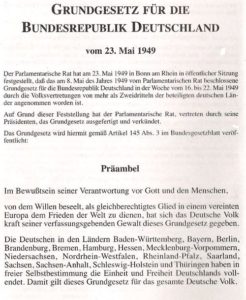Gesetze regeln viele Materien nur recht grob und allgemein. Daher erlauben die Gesetze für zahlreiche Einzelfragen die Regelung durch die Regierung selbst. Diese Verordnungen müssen nicht auf den komplizierten weg der Gesetzgebung gehen, sondern können recht schnell verabschiedet werden. Wer für die Verordnung zuständig ist, wird im Gesetz selbst festgelegt. Gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes können „die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen“ ermächtigt werden.
Nun wurde aber das „Gesetz über Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen“ durch Artikel 3 des „Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz“ (2. BMJBBG) aufgehoben. Dieser Artikel besagt schlicht und einfach:
Das Gesetz über Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 103-1, veröffentlichten bereinigten Fassung wird aufgehoben.
Teilweise wird das etwas falsch verstanden, es wird sogar so getan als wäre damit die Kompetenz zum Verordnungserlass insgesamt aufgehoben. Das ist aber schon deswegen nicht der Fall, weil sich die Möglichkeit der Verordnungsermächtigung aus dem Grundgesetz ergibt, siehe oben. Die Ermächtigung als solche ist dann im jeweiligen Gesetz enthalten. Tatsächlich betraf dieses Gesetz nur einen ganz geringen Teil von Verordnungen. Der einzige bedeutende Paragraph dieses Gesetzes war der erste:
Gesetz über Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen – § 1
Soweit Bundesgesetze Ermächtigungen oberster Landesbehörden zum Erlaß von Rechtsverordnungen vorsehen, sind die Landesregierungen zum Erlaß dieser Rechtsverordnungen ermächtigt. Die Landesregierungen können die Ermächtigungen auf die obersten Landesbehörden übertragen, die in den bisherigen Vorschriften bezeichnet sind, und dabei die weitere Übertragung auf nachgeordnete Behörden in dem bisher bezeichneten Umfang zulassen.
Das bedeutet also, dass in jedem Gesetz, das es obersten Landesbehörden oder einzelnen Landesministern erlaubte, Verordnungen zur Ausführung des Gesetzes zu erlassen, diese Ermächtigung so zu lesen war als hätte dort eine Ermächtigung für die gesamte Landesregierung gestanden.
Der Grund dafür lag in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, genauer gesagt im Beschluss des Zweiten Senats vom 10. Mai 1960, Az. 2 BvL 76/58, abgedruckt in BVerfGE 11, 77. Das Gericht entschied darin:
Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG kann außer an die Bundesregierung oder an einen Bundesminister nur an eine Landesregierung, nicht an einen Landesminister gegeben werden.
Eine Ermächtigung durfte also nicht z.B. den Landesjustizminister ermächtigen, sondern nur die Landesregierung insgesamt. Wenn die Landesregierung nun wollte, dass der Landesjustizminister für bestimmte Angelegenheiten allein zuständig ist, musste sie das in ihrer Geschäftsordnung oder auf andere Weise selbst beschließen. Den Bundesgesetzgeber ging diese landesinterne Aufgabenverteilung aber nichts an, so das BVerfG.
Begründet wurde dies damit:
Grundsätzlich respektiert die Bundesverfassung die Verfassungsordnung der Länder; ein Eingriff der Bundesgewalt in die Verfassungsordnung der Länder ist nur zulässig, soweit es das Grundgesetz ausdrücklich bestimmt oder zuläßt.
Um diesen Richterspruch umzusetzen, ohne alle Gesetze einzeln ändern zu müssen, wurde daher das Gesetz über Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen erlassen. Dieses bestimmte, dass alle Gesetze, die diese „falsche“ Ermächtigung eines Landesminister beinhalteten, nun „richtig“ zu lesen waren, also die gesamte Landesregierung ermächtigten.
Weil aber seit diesem Beschluss fast 60 Jahre ins Land gegangen sind und es heute wohl kaum noch ein Gesetz gibt, das diese Zuweisung beinhaltet, konnte man das Gesetz nun endlich aufheben. Höchstvorsorglich ließ man diesen Artikel auch noch etwas später in Kraft treten, nämlich nicht schon im November 2007, sondern erst zum 1. Dezember 2010. Hätte man also noch ein fehlerhaftes Gesetz gefunden, hätte sich das noch reparieren lassen. Seitdem sind aber keine Beschwerden dahingehend bekannt, dass irgendeine Landesregierung ihrer Verordnungsermächtigung verlustig gegangen wäre.