 Im Jahr 1992 soll die Hannoveranerin Franziska Sander von ihrem Ehemann getötet und die Leiche in einem Metallfass versteckt worden sein. Während man zunächst davon ausging, dass sich die Frau ins Ausland abgesetzt hat, wurde ihr Verschwinden erst im Jahr 2013 näher ermittelt. 2016 wurde schließlich ihr Körper gefunden. Medien berichten, der Mann habe gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet zu haben. Möglicherweise geht er straffrei aus, denn ein Totschlag wäre verjährt.
Im Jahr 1992 soll die Hannoveranerin Franziska Sander von ihrem Ehemann getötet und die Leiche in einem Metallfass versteckt worden sein. Während man zunächst davon ausging, dass sich die Frau ins Ausland abgesetzt hat, wurde ihr Verschwinden erst im Jahr 2013 näher ermittelt. 2016 wurde schließlich ihr Körper gefunden. Medien berichten, der Mann habe gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet zu haben. Möglicherweise geht er straffrei aus, denn ein Totschlag wäre verjährt.
Dazu drängen sich Fragen auf:
Warum verjährt eine Straftat überhaupt?
Fast alle Strafgesetze der Welt kennen das Rechtsinstitut der Verjährung. Nach einer gewissen Zeit sollen Straftaten einfach nicht mehr verfolgbar sein. Die Gründe dafür sind folgende:
- Schwund an Beweismitteln. Je länger eine Tat zurückliegt, desto schwerer wird es, sie nachzuweisen. Sachbeweise verschwinden, Zeugen können sich nicht mehr erinnern etc.
- Schuldtilgung. Wer sich seit einer Straftat jahrelang nicht mehr strafbar gemacht hat, dem soll nicht sein altes Fehlverhalten zum Vorwurf gemacht werden. Der Täter hat sich praktisch selbst resozialisiert, ein Anlass für strafrechtliche Sanktion besteht dann nicht mehr.
- Ressourcen. Durch die Verjährung wird das Prüfungsprogramm der Behörden in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt. Die Staatsanwaltschaften und die Gerichte sollen sich auf aktuelle Verbrechen konzentrieren, nicht auf lange zurückliegende Sachverhalte.
Diese Argumente sind bei einem Tötungsverbrechen zugegebenermaßen aber nur begrenzt tragfähig.
Wann verjährt Totschlag?
Totschlag ist gemäß § 212 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren bedroht. Solche Straftaten, bei denen die Höchststrafe mehr als zehn Jahre beträgt, verjähren nach 20 Jahren (§ 78 Abs. 3 Nr. 2 StGB). Hier haben die Ermittlungen aber erst 21 Jahre nach der Tat begonnen.
Dass besonders schwere Fälle des Totschlags mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind (§ 212 Abs. 2) und bei solchen Straftaten an sich erst nach 30 Jahren Verjährung eintritt (§ 78 Abs. 3 Nr. 1 StGB), ist nicht relevant. Die Strafandrohungen besonders schwerer Fälle ändern nichts an der Dauer der Verjährung (§ 78 Abs. 4).
 Ändert sich etwas an dieser Frist, weil die Tat nicht bekannt war?
Ändert sich etwas an dieser Frist, weil die Tat nicht bekannt war?
Nein. Während die Verjährung im Zivilrecht häufig von der Kenntnis des Anspruchsinhabers abhängig ist, gilt das im Strafrecht gerade nicht. Hier ist es ja das Wesen der Verjährung, dass die Staatsanwaltschaft nichts von einer Straftat weiß. Würde man darauf warten müssen, dass die Behörden trotz Kenntnis von einem Sachverhalt 20 Jahre lang nicht ermitteln, würde das Rechtsinstitut der Verjährung völlig leerlaufen.
Die strafrechtliche Verjährungsfrist beginnt daher, sobald die Tat einschließlich des vom Tatbestand vorausgesetzten Erfolgs beendet ist (§ 78a).
Ist es nicht so, dass Mord nie verjährt?
Doch, das ist so. Gemäß § 78 Abs. 2 StGB verjährt Mord nicht. Allerdings deuten die Ermittlungen bisher darauf hin, dass hier nur Totschlag vorliegt. Für Totschlag gilt § 78 Abs. 2 aber nicht, ein solches Verbrechen verjährt also nach den allgemeinen Vorschriften.
Warum war es hier kein Mord?
Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, dass bei ersterem ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegt. § 211 Abs. 2 sagt:
Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.
Nicht notwendig ist dagegen, dass ein Mord geplant wird. Dementsprechend schließt auch eine Tat nach einem Streit oder sonst im Affekt einen Mord noch nicht aus. Andererseits stellen die Mordmerkmale aber auch besondere Motivlagen und Begehungsweisen dar, die bei spontanen Taten selten vorliegen.
So liegt es wohl auch hier, wenn die Medienberichte korrekt sind: Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen ist kein Mordmerkmal erfüllt. Wenn sich der Ehemann nicht im weiteren Verlauf der Verfahrens selbst belastet, wird es wohl dabei bleiben. Dann ist die Verjährung zweifellos eingetreten.
Das mag vielleicht bei einem Tötungsdelikt schwer erträglich sein, aber es ist nun einmal eine Konsequenz aus den Verjährungsvorschriften, für die es – siehe oben – gute Gründe gibt. Will man angesichts dieses (absolut seltenen) Falls die Verjährung auch für Totschlag ausschließen, muss das Gesetz eben entsprechend geändert werden.
 Heute wählen die Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten – so zumindest die allgemeine Meinung. Es könnte aber auch sein, dass die Amerikaner wählen und trotzdem niemand Präsident wird. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders wahrscheinlich – aber für wie wahrscheinlich hätte man es vor ein paar Jahren gehalten, dass Hillary Clinton und Donald Trump als die beiden geeignetsten Kandidaten für das mächtigste Amt der Welt angesehen würden?
Heute wählen die Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten – so zumindest die allgemeine Meinung. Es könnte aber auch sein, dass die Amerikaner wählen und trotzdem niemand Präsident wird. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders wahrscheinlich – aber für wie wahrscheinlich hätte man es vor ein paar Jahren gehalten, dass Hillary Clinton und Donald Trump als die beiden geeignetsten Kandidaten für das mächtigste Amt der Welt angesehen würden? Das Bundesjustizministerium hat vor einiger Zeit einen Referentenentwurf zu einer StPO-Reform veröffentlicht, der einige Änderungen des Strafprozessrechts zum Ziel hat. Das Gesetz soll den salbungsvollen Titel „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ tragen. Es wird einige traditionelle Grundsätze im deutschen Strafprozess verändern, darum läuft derzeit eine intensive Debatte zwischen verschiedenen juristischen Organisationen, die alle ihre Ansichten dazu einbringen wollen.
Das Bundesjustizministerium hat vor einiger Zeit einen Referentenentwurf zu einer StPO-Reform veröffentlicht, der einige Änderungen des Strafprozessrechts zum Ziel hat. Das Gesetz soll den salbungsvollen Titel „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ tragen. Es wird einige traditionelle Grundsätze im deutschen Strafprozess verändern, darum läuft derzeit eine intensive Debatte zwischen verschiedenen juristischen Organisationen, die alle ihre Ansichten dazu einbringen wollen. Wie der bei einem Unternehmen angestellte Jurist (Syndikus) sozialversicherungsrechtlich zu behandelt ist, war lange umstritten. Nachdem ihn die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in die Rentenversicherung zwang, hat der Gesetzgeber im „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte“ eine Ausnahme geschaffen.
Wie der bei einem Unternehmen angestellte Jurist (Syndikus) sozialversicherungsrechtlich zu behandelt ist, war lange umstritten. Nachdem ihn die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in die Rentenversicherung zwang, hat der Gesetzgeber im „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte“ eine Ausnahme geschaffen. Gerade in Grundschulen herrscht oft – Ausnahmen bestätigen die Regel – ein freundliches bis herzliches Klima zwischen Eltern und Lehrern. Meistens übernimmt die Klassenlehrerin so gut wie alle Fächer und hat damit eine enge Bindung zu den Schülern. So liegt es nahe, dass die Eltern sich für die gute Arbeit bedanken wollen und gerade in der Adventszeit der Lehrkraft ein Geschenk machen wollen.
Gerade in Grundschulen herrscht oft – Ausnahmen bestätigen die Regel – ein freundliches bis herzliches Klima zwischen Eltern und Lehrern. Meistens übernimmt die Klassenlehrerin so gut wie alle Fächer und hat damit eine enge Bindung zu den Schülern. So liegt es nahe, dass die Eltern sich für die gute Arbeit bedanken wollen und gerade in der Adventszeit der Lehrkraft ein Geschenk machen wollen. Im Jahr 1992 soll die Hannoveranerin Franziska Sander von ihrem Ehemann getötet und die Leiche in einem Metallfass versteckt worden sein. Während man zunächst davon ausging, dass sich die Frau ins Ausland abgesetzt hat, wurde ihr Verschwinden erst im Jahr 2013 näher ermittelt. 2016 wurde schließlich ihr Körper gefunden. Medien berichten, der Mann habe gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet zu haben. Möglicherweise geht er straffrei aus, denn ein Totschlag wäre verjährt.
Im Jahr 1992 soll die Hannoveranerin Franziska Sander von ihrem Ehemann getötet und die Leiche in einem Metallfass versteckt worden sein. Während man zunächst davon ausging, dass sich die Frau ins Ausland abgesetzt hat, wurde ihr Verschwinden erst im Jahr 2013 näher ermittelt. 2016 wurde schließlich ihr Körper gefunden. Medien berichten, der Mann habe gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet zu haben. Möglicherweise geht er straffrei aus, denn ein Totschlag wäre verjährt. Ändert sich etwas an dieser Frist, weil die Tat nicht bekannt war?
Ändert sich etwas an dieser Frist, weil die Tat nicht bekannt war? Prüfungsanfechtungen sind schwierig und erfordern eine sehr zielgerichtete Klagebegründung. Allgemeines Vorbringen, die Note sei nicht angemessen, führt niemals zum Erfolg. Vielmehr müssen dem Prüfer tatsächliche Bewertungsfehler nachgewiesen werden.
Prüfungsanfechtungen sind schwierig und erfordern eine sehr zielgerichtete Klagebegründung. Allgemeines Vorbringen, die Note sei nicht angemessen, führt niemals zum Erfolg. Vielmehr müssen dem Prüfer tatsächliche Bewertungsfehler nachgewiesen werden.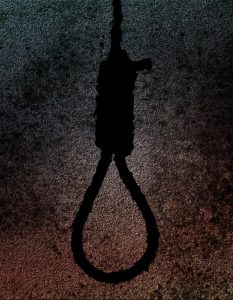 Heute vor 70 Jahren wurden die Todesurteile aus dem Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vollstreckt. Grund genug, sich diesen Meilenstein der Juristerei einmal genau anzusehen. Darum haben wir einzelne Aspekte des Prozesses herausgegriffen und kurz bewertet:
Heute vor 70 Jahren wurden die Todesurteile aus dem Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vollstreckt. Grund genug, sich diesen Meilenstein der Juristerei einmal genau anzusehen. Darum haben wir einzelne Aspekte des Prozesses herausgegriffen und kurz bewertet: